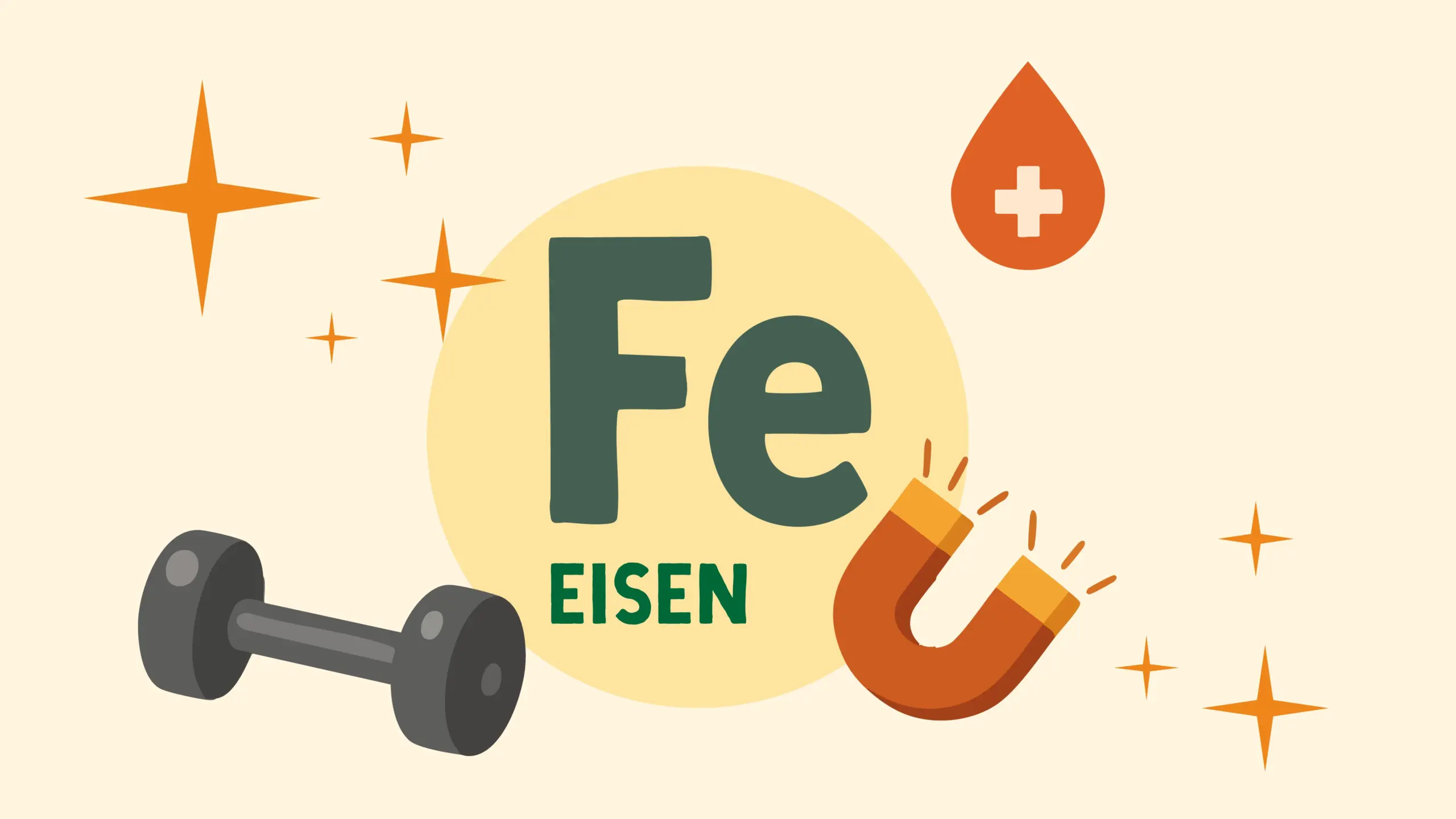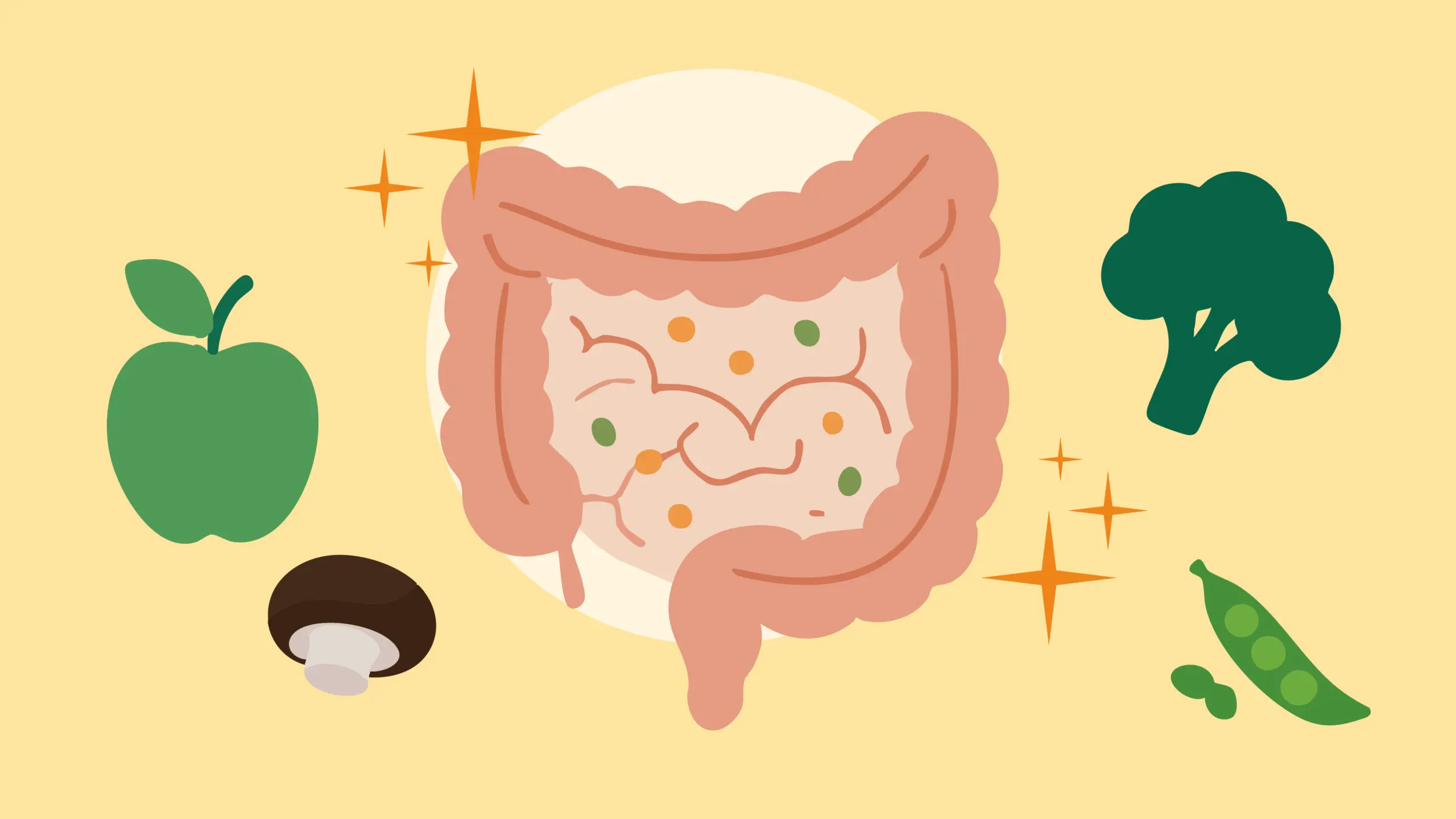Die Herausforderung: Unsere Alltagsgewohnheiten, eine oft unausgewogene Lebensmittelauswahl und ein Überangebot an stark verarbeiteten Produkten erschweren eine gesunde Ernährung – bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen. Selbst sportlich aktive Menschen greifen nicht automatisch zu den nährstoffreichsten Lebensmitteln.
Hier setzt die Sporternährung an: Sie hilft dabei, über eine bewusste Auswahl und gezielte Anpassungen die körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern und langfristig gesund zu bleiben. Besonders wichtig ist dabei ein ausgewogenes Verhältnis aller Nährstoffe, anstatt sich auf einzelne „Schlüsselkomponenten“ wie Protein oder Calcium zu konzentrieren.
Der nachfolgende Lehrbrief von Prof. Dr. Werner Seebauer liefert dir wissenschaftlich fundierte Informationen zur Ernährung im Leistungssport. Er zeigt auf, wie du deine Ernährung gezielt an die Anforderungen deines Trainings anpassen kannst – mit Fokus auf Nährstoffqualität, Mengenverhältnisse und richtige Zeitpunkte der Zufuhr.
Gesunde Sporternährung – das Wichtigste zusammengefasst:
- Eine ausgewogene, gesunde Ernährung bildet die Grundlage – auch im Leistungssport. Die Empfehlungen orientieren sich an anerkannten Leitlinien (z. B. DGE, Harvard School), werden aber je nach Trainingsziel und Belastung gezielt angepasst.
- Gerade bei hoher körperlicher Beanspruchung ist das richtige Timing entscheidend: Wann, wie viel und was du isst und trinkst, beeinflusst nicht nur deine Leistungsfähigkeit, sondern auch deine Regeneration.
- Häufig besteht Optimierungspotenzial weniger in exotischen Produkten, sondern in der konsequenten Umsetzung einfacher Grundprinzipien – z. B. der ausreichenden Flüssigkeitszufuhr oder der Qualität der Kohlenhydrate.
Über Gast-Prof. Dr. Werner Seebauer Experte für Präventionsmedizin, Ernährung und Leistungsoptimierung
Prof. Seebauer steht wie kaum ein anderer für fundiertes Ernährungswissen und ganzheitliche Gesundheitsförderung und Prävention. Er war lange Jahre Gast-Professor an der Europa- Universität Viadrina beim Weiterbildungsstudiengang „komplementäre Medizin“ für Ärzte. Aktuell bringt er als Gast-Prof. und Leiter der Präventionsmedizin in der New European Surgical Academy und der ISBA University of Cooperative Education Freiburg sowie Studienleiter des Verbandes Deutscher Präventologen ernährungswissenschaftliches Know-how in der Lehre und Praxis zusammen.
Für die Österreichische Gesellschaft für Sporternährung ist er wissenschaftlicher Beirat und Mitautor beim „Lehrbuch der Sporternährung“. Er war selbst Leistungssportler im brasilianischen Nationalkader für Langstrecken-Outrigger-Rennen (Ocean-Paddel-Competitions) – was ihn zusätzlich besonders nahbar und spezialisiert macht, wenn es um praktische Ernährungstipps und die Leistungssteigerung durch Vitalstoffe der Nahrung geht.
Seine Mission: Menschen zu einem gesünderen Lebensstil zu inspirieren – und wissenschaftlich fundiert, alltagstauglich die State of Science der Ernährung zu erklären. Daher schreibt er auch gerne für uns Informationen zu den Ernährungsthemen und „komplexere Lehrbriefe“ im Zusammenhang mit der „natürlichen Matrix der Nährstoffe“, für alle, die mehr zu Ihrer Ernährung lernen wollen.
Inhalt
Einleitung
In diesem Kurz-Lehrbrief wird ein Einblick zum Thema „Sporternährung“ sowohl für Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche gegeben.
Grundsätzlich kann man sagen, dass die „Sporternährung“ für alle Gruppen in der Basis vor allem den allgemeinen Empfehlungen zu einer ausgewogenen Ernährung entsprechen sollte, wie sie in den Ernährungspyramiden und Ernährungskreisen der Fachgesellschaften (z.B. der DGE oder der Harvard School of Public Health) empfohlen werden. Dabei ist zu betonen, dass in besonderen Wachstumsphasen es noch wichtiger ist, auf die ausreichende und ausgewogene Versorgung mit Makro- und Mikronährstoffen zu achten.
Man kann hierbei zwar, wie oft üblich, aufgrund des forcierten Wachstums der Knochen (Kinder und Jugendliche) und generell Muskulatur, bestimmte Faktoren anführen, wie die Calcium- oder Proteinzufuhr, doch dies ist dann immer eine zu begrenzte Betrachtung, denn immer sind viele weitere Faktoren im Funktionskomplex gleichzeitig beteiligt. Also appelliere ich auch an dieser Stelle, weniger auf einzelne Nahrungskomponenten zu schauen, die für bestimmte Bereiche Schlüsselfaktoren sein mögen, als vielmehr auf das gute Funktionieren des gesamten wachsenden Organismus zu schauen, wofür das ausbalancierte Zusammenwirken aller Nährstoffe wichtig ist.
Wenn man sich ausgewogen entsprechend den Ernährungsempfehlungen nach den Ernährungspyramiden ernährt und in Wachstumsphasen die Zufuhrmenge ohnehin steigert, versorgt man sich mit allen notwendigen Nährstoffen* (mit Ausnahme von Vitamin D, das nur zu circa 10% aus der Nahrung stammt und dessen Produktion vor allem über Sonnenkontakt auf der Haut produziert resultiert).
*Der gesunde Organismus steuert den Bedarf und somit die Versorgung mit den Nährstoffen bei einem funktionierenden Hunger-Sättigungsgefühl automatisch, sowohl in den Wachstumsphasen sowie bei gesteigerter physischer Aktivität (Sport, etc.).
Die Herausforderung besteht jedoch häufig in der Frage des „Wenn“: Die Nahrungsmittelangebote und die Verführung zu unausgewogener Ernährung sind Probleme, die viele Eltern kennen und die auch in Ernährungsstudien nachgewiesen werden (z.B. durch nationale Verzehrsstudien in Deutschland). Spezielle Ernährungsanalysen bei Kindern und Jugendlichen,
wie beispielsweise die KiGGS-Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, die in den Jahren 2003-2006 sowie 2014-2017 durchgeführt wurde, zeigen immer wieder, dass der Verzehr von Obst und Gemüse stark unter den Empfehlungen liegt.
Nur 14 % der Kinder und Jugendlichen erreichen die Mindestmenge von fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag. Darüber hinaus sind auch andere Qualitätsfaktoren, wie die Auswahl der Cerealien sowie der Verzehr von Hülsenfrüchten und Samen, oft unzureichend im Speiseplan vertreten. Bei Erwachsenen ändert sich das Ernährungsverhalten nur teils zum Besseren, teils zum Schlechteren. Einmal bestehende Gewohnheiten, wie die unausgewogene Ernährung, manifestieren sich oft langfristig. Der Sport kann zwar die „somatische Intelligenz“ anregen, eher nach wertvolleren Lebensmitteln zu greifen, doch dennoch sieht man auch bei Sportlern oft einen Bedarf zu Verbesserung der Ernährung. Insgesamt sieht man dies beim absolut größten Bevölkerungsanteil.
Umso wichtiger ist es, als Basis der Ernährung (auch bei der Sporternährung!), die allgemeinen Ernährungsempfehlungen umzusetzen. Dies gilt sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene. Daher müssen wir primär daran erinnern und wiederholt die Konzepte gesunder Ernährung aufzuzeigen. Hierzu helfen die Orientierungshilfen und Leitfäden wie in der Ernährungspyramide und den Ernährungskreisen werden (siehe Teil 2 praktische Anleitungen) – für Kinder und Jugendliche gibt es diesbezüglich spezifische Unterschiede zu Erwachsenen – z.B. den Verzicht auf Alkohol bei Kindern und Jugendlichen, und auch den Verzicht auf Genussmittel wie Kaffee bei Kindern. (siehe Anhang)
Die Basis dieser Pyramide bildet eine Vielzahl nährstoffreicher, unverarbeiteter oder nur minimal verarbeiteter Lebensmittel – fokussiert also auf die Qualität. Dazu gehören Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Samen, Nüsse und Küchenkräuter. Der Ernährungskreis zeigt die empfohlene Mengenverteilung bzw. Quantität der Lebensmittelgruppen. Für den Leistungssportler wird dabei die Quantität der Kohlenhydrate enthaltenen Lebensmittel erhöht, da dies die effizientesten Energielieferanten für den Sport sind. Der Bedarf von mehr Proteinen wird oft überschätzt. Für beide Makronährstoffe und die Flüssigkeitszufuhr gibt es spezielle Timing-Konzepte (siehe Lehrbrief).
Am häufigsten liegt bei der „Sporternährung“ das Optimierungspotential bei der Flüssigkeitsversorgung und Kohlenhydratzufuhr in Zeitpunkt, Art und Dosis.
Eine abwechslungsreiche Auswahl an Lebensmitteln ist entscheidend, um von den zahlreichen „Sekundären Pflanzenstoffen“ zu profitieren, die gesundheitsfördernde Eigenschaften besitzen. Generell sollte Gemüse und Obst möglichst in vollreifem Zustand geerntet und frei von Schadstoffen sein. Um das Risiko von Schadstoffen in der Nahrung zu minimieren, sind biologisch angebaute Lebensmittel ohne künstliche Zusätze zu bevorzugen. Zudem sollten Verarbeitungsprozesse, die den Schadstoffgehalt erhöhen, so weit wie möglich vermieden werden. Im Allgemeinen ist es auch ratsam, auf die Dosis bestimmter Lebensmittel zu achten, die von Natur aus höhere Konzentrationen von Schadstoffen enthalten können, wie z.B. Schwermetalle oder Nitrate, etc. (zu diesen Themen folgen Lehrbriefe).
Die gesunde Zusammenstellung von Nährstoffen in Dosis und Qualität ist für Breiten – wie Leistungssportler gleichermaßen wichtig, um späteren Folgeschäden oder Erkrankungen vorzubeugen. Es gibt jedoch Unterschiede zu den allgemeinen Empfehlungen, insbesondere hinsichtlich der Ballaststoffzufuhr kurz vor, während und nach körperlicher Betätigung, da diese zwar allgemein sehr gesundheitsfördernd sind, doch die Verdauung verlangsamt ist und somit die sportliche Performance oder die Regeneration reduziert wird. Also sind zu diesen Zeitpunkten Lebensmittel mit geringerem Ballaststoffgehalt von Vorteil. Dies bedeutet dennoch, dass auch die Leistungssportler in geeigneten Phasen ihres Trainingsplans und in Abstand zu den Competitions die Ernährungskonzepte der allgemeinen Gesundheitsförderung und Prävention, mit dann auch reichlich Ballaststoffen, einbauen sollten; das Timing und die Zusammenstellung sind dabei individuell anzupassen.
Die gezielten Anpassungen der Sporternährung sind primär auf den Leistungssport ausgerichtet. Während nicht leistungsorientierte Sportler freilich auch von einigen dieser Maßnahmen profitieren können, ist eine detaillierte Umsetzung in ihrem Fall häufig nicht notwendig. Im Breitensport spielt die strikte Einhaltung spezifischer Vorgaben der Sporternährung in der Regel eine untergeordnete Rolle. Für Leistungssportler hingegen ist eine präzise Anpassung der Ernährung zur Optimierung ihrer sportlichen Leistung ratsam – ja, für die Spitzenleitung oft erforderlich.
Zusätzlich zur allgemeinen Ernährung, entsprechend den Leitfäden einer gesunden und ausgewogenen Ernährung, ist es für den Leistungssportler dann wichtig, die spezifischen Anforderungen im Sport zu berücksichtigen. Bei intensivem Training oder Leistungssport sind Anpassungen in der Ernährung, insbesondere hinsichtlich Quantität und Timing der Flüssigkeits- und Mineralstoffversorgung, sowie der Energiequellen, notwendig, um die Trainingseffekte, die sportliche Leistung und die Regeneration zu optimieren. Dies wird im Folgenden in Teil 1 dieses Lehrbriefs erklärt und in Teil 2 mit Beispielen von Kompositionen entsprechend unterschiedlicher Zeiten (vor, während und nach dem Sport) verdeutlicht.
Anmerkung
Es ist von grundlegender Bedeutung zu betonen, dass das adäquate Trainingskonzept als der entscheidende Faktor für die Leistungssteigerung gilt („Leistungssteigerer“ Nummer Eins). Während die Ernährung zweifellos eine signifikante unterstützende Rolle spielt, vermag sie ein unzureichendes Training nicht zu kompensieren. Vor allem kommt der Ernährung eine Schlüsselrolle bei der langfristigen Gesundheitsförderung zu. Und je besser es gelingt, Defizite zu vermeiden und die Regeneration zu optimieren, desto effektiver sind die Trainingseffekte und desto nachhaltiger die Leistungsfähigkeit. Das übergeordnete Ziel besteht darin, die langfristige Gesundheit und Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter zu gewährleisten, was durch die optimale Synergie von Training, Ernährung und Erholungsphasen erreicht werden kann.
Kohlenhydrate als wichtigste und effizienteste Energiequelle für den Sport
Kohlenhydrate stellen die effizientesten Energielieferanten dar, insbesondere im Leistungssport, da sie für die Energiegewinnung am wenigsten Sauerstoff verbrauchen (respiratorischer Quotient).
Für den Sport sollte die tägliche Ernährung im Allgemeinen eine angepasste Zufuhr von Kohlenhydraten beinhalten, um die effizientesten Energielieferanten für sportliche Aktivitäten zu liefern. Besonders bei intensiven längeren Aktivitäten, die über 60 Minuten dauern, sowie bei bereits ab 45 Minuten bei sehr hohen Intensitäten ist eine zusätzliche Kohlenhydratzufuhr von Vorteil (während des Sports überwiegend in Form von Getränken mit auch Elektrolyten). Um die Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur und Leber (die Glykogenspeicher) optimal aufzufüllen, ist es vorteilhaft, bereits einige Tage vor der Belastung ausreichend kohlenhydratreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen. Zu den verschiedenen Zeitpunkten – vor, während und nach dem Sport – sind dabei unterschiedliche Kohlenhydratformen, bzw. Lebensmittel empfehlenswert.
Idealerweise sollte die Glykogenspeicherauffüllung über mehrere Tage erfolgen und spätestens mehrere Stunden vor der Belastung geschehen. Die früher häufig empfohlenen Konzepte der Glykogen-Superkompensation (z.B. nach Saltin), welche zeitweiligen Kohlenhydratmangel und Intervalltraining einschließen, sind in der Regel nicht notwendig, solange eine kontinuierliche und ausreichende Kohlenhydratzufuhr im Trainingsalltag gewährleistet ist.
Trainingsumfang und Kohlenhydratbedarf
Anmerkung
Bei geringer sportlicher Belastung unter einer Stunde ist die Zufuhr von Kohlenhydraten über ein Getränk nicht relevant (es kann sogar ein Nachteil bestehen, wenn bei geringem Bewegungsumfang gesüßte Getränke konsumiert werden).
Je höher der Trainingsumfang oder die Belastungszeit bei einer Competition ist, desto höher ist der Kohlenhydratbedarf für optimale Effekte. Wie betont sollten bei höherem Umfang bereits vor und während dem Sport (zur Leistungsoptimierung), und nach dem Sport (zur schnelleren Regeneration – Glycogenresynthese) mehr Kohlenhydrate konsumiert werden:
- 2-4h vor dem Sport sollten Kohlenhydrate (1-1,5g KH/kgKG) zusammen mit Flüssigkeit zugehführt werden: (5-7ml/kgKG mit ca. 1,5-1,7g NaCl/L und 50-80g KH/L* – bei gut adaptierten Sportlern bis zu 90gKH/L). * vor dem Sport sind Elektrolyte im Getränk noch nicht unbedingt notwendig; während des Sports von längerer Dauer (siehe Kapitel Flüssigkeitszufuhr) sollte Natrium zwingend enthalten sein.
- während dem Sport liegt die optimale Kohlenhydrat-Utilisierung bei etwa 1gKH/kgKG/Stunde; (also bei 70 kg >> 70gKH/Stunde z.B. über 1 Liter Getränk mit 7% KH). Angebracht bei Belastungen länger als 60 Minuten – bei hohen Intensitäten ab 45 Minuten – jeweils zusammen mit genügend Flüssigkeit und Natriumchlorid – bei Hitze Getränk bereits ab 30 Minuten – siehe unten).
- nach dem Sport zur Regeneration 1-1,5g /kgKG/h alle 1-2h über 4-6 Stunden zur
Wiederauffüllung der Glycogenspeicher (im ersten Zeitfenster von 30 Minuten beginnen) Flüssigkeit und Kohlenhydrate sowie Natrium in adäquater Dosis.
(Kohlenhydrate KH; Kilogramm Körpergewicht kgKG; Natriumchlorid NaCl)
Wenn die Wiederauffüllung der Glycogenspeicher mehr Zeit erlaubt (z.B. nicht am gleichen Tag oder am nächsten Tag nicht wieder intensives Training folgt), kann die Kohlenhydrat-Dosis innerhalb von 24h entsprechend dem Belastungsumfang und jeweils leistungsorientiertem Training folgend angepasst werden:
- 5-7g KH/kgKG/Tag für moderates Training (ca. 1 Stunde Training / Tag)
- 6-10g KH/kgKG/Tag für mehr Training (≥1-3 Stunden Training / Tag)
- bis zu 12g KH/kgKG/Tag für mehr als 4 Stunden Training
(Empfehlungen auch des American College of Sport Medicine 2009)
Die ideale Zusammenstellung kann individuell variieren. Man stellt die Ernährung nach Analyse verschiedener Faktoren zusammen, wobei auch die verschiedenen Toleranzen abgeklärt werden (wie in anderen Lehrbriefen betont interagieren hierbei verschiedene Systeme – z.B. die Darmverhältnisse [Darmflora, etc.] mit dem Immunsystem, individueller Genetik, etc.).
Sportlern wird geraten, vermehrt Cerealien (z.B. Müsli, Brot, Nudeln, fettarmes Gebäck) und Obst (z.B. Beeren, Banane, Papaya) sowie Reis und Kartoffeln (keine Pommes) und leichter Verdaubares Gemüse (z.B. gedünstet: Karotten und Tomaten, Brokkoli, etc.] zu konsumieren, da diese Lebensmittel leicht verdaulich sind und weniger schwer lösliche Ballaststoffe enthalten.
Sportriegeln, Obst (auch schonend gefriergetrocknet als lange haltbare und gut transportierbare Form) oder Kekse sind für die Anwendung bei Sport ideal (z.B. während eines Sportveranstaltung zwischendurch).
Hülsenfrüchte, wie Linsen Kichererbsen oder Soja, sind mit einem zeitlichen Abstand von 8-12h vor und ab 3 Stunden nach dem Sport sehr gut; auch sie können nach vorheriger Erhitzung in gefriergetrockneter Form leicht anwendbar sein z.B. in Müsli oder als Snack zum Getränk.
Hülsenfrüchte können schwerer verdaulich sein, weshalb zur guten Verträglichkeit eine angemessene Verarbeitung wichtig ist. Sojaprodukte sind in der Regel so aufbereitet, dass sie gut verdaulich und gut verträglich sind. Auch eine geringe Menge von verarbeiteten Kichererbsen, Erbsen oder anderen Hülsenfrüchten, beispielsweise als Pulver für Shakes oder Riegeln, kann nach dem Sport aufgrund der guten Kombination von Kohlenhydraten und Proteinen vorteilhaft sein.
Nüsse und Samen sind hingegen besser erst mit 6 Stunden Abstand nach der Belastung (Training und insbesondere Competition) in nicht zu großer Menge zu empfehlen. Obwohl sie gesund sind, können sie aufgrund ihres höheren Fettgehalts die Verdauung und damit die Leistungsfähigkeit während des Sports und die Regenerationsgeschwindigkeit nach dem Sport, beeinträchtigen.
Für wichtige Competitions ist es ratsam, keine neuen oder ungewohnten Lebensmittel zu konsumieren, um mögliche Verträglichkeitsprobleme zu vermeiden. Daher sollte eine schritt-weise Gewöhnung z.B. an Hülsenfrüchte im Speiseplan erfolgen.
Alle Lebensmittel mit einem hohem Fett- oder Proteingehalt können die Geschwindigkeit der Kohlenhydratverwertung und Flüssigkeitsversorgung reduzieren, was sich negativ auf die Leistung auswirken kann.
Auch Lebensmittel mit hohen Anteilen schwerer resorbierbarer Kohlenhydratformen (Zuckerformen wie insbesondere Sorbit, und Sucralose, Acesulfam, Mannit, Xylit, etc.), die heutzutage öfters sogar inadäquat als Ballaststoffe in Sport-riegeln oder Proteinpulvern bezeichnet werden, sind vorsichtig abzuwägen, da sie den Darm zu sehr belasten können, wenn sie zu hoch dosiert oder aber z.B. während einer längeren Belastung (z.B. Ausdauersport) konsumiert werden.
In solchen Situationen, in denen bereits eine erhöhte Zufuhr von Glucose und Fructose über Sportgetränke erfolgt, kann schon ein etwas zu hoher Fructoseanteil zu Magen-Darm-Problemen führen.
Flüssigkeitszufuhr und Elektrolyte
Die Flüssigkeitszufuhr spielt eine entscheidende Rolle für die Leistungsfähigkeit. Sie sollte bereits im Alltag höher als oft üblich sein sowie 1-2 Stunden und 20 Minuten vor der sportlichen Aktivität nochmals extra stattfinden – insbesondere bei längeren oder intensiven Belastungen. Um zusätzliche Wasser-Reserven des Körpers zu steigern, braucht es die reichliche Zufuhr täglich – am besten bereits mindestens eine Woche vor der Belastung (Competitions oder vor intensiven Trainingseinheiten). Dies bezeichnet man als Hyperhydratation.
Das gezielte Trinken von größeren Flüssigkeitsmengen hat Vorteile, wenn es auf viele Portionen verteilt ist. Dadurch ist die Auffüllung von Speichern im Körper (z.B. über das Plasmavolumen, und die Wasserbindung an Glycogen, etc.) effektiver. Also das stetig gute Trinken vor allem von Wasser ist zusätzlich eine hilfreiche Strategie.
Bereits ohne Sport besteht für optimale Verhältnisse ein höherer Flüssigkeitsbedarf als vielfach angenommen wird.
Bei 20-22°C kann man 40-45 ml Wasser pro kg Körpergewicht (KG) als Mindestwert berechnen:
- Das entspricht etwa 3 Liter bei 70kg und 2 Liter bei 50kg KG
- Oder als gröbere Orientierung 4% des Körpergewichts
Jeweils berechnet aus Getränken und Nahrungsmitteln (insbesondere mit höherem Wasseranteil).
> Beim Tagebedarf von 2,0L resultiert dies bei ausgewogener und gut zusammengestellter Ernährung aus circa: >> 1,0-1,5 L Getränk >> + in Lebensmitteln gebundenes Wasser 500-750 ml,
>> + Stoffwechselwasser 250 ml
Alle Flüssigkeit, die durch Schwitzen verloren wird, muss zusätzlich zum Grundbedarf getrunken werden.
Während körperlicher Aktivität entsteht zwangsläufig Wärme in der Muskulatur (bei intensiver Aktivität erreicht die „Muskelkerntemperatur“ sogar bis annähernd 39°C), weshalb zur Senkung bzw. Thermoregulation die erhöhte Schweißproduktion erforderlich ist. Bereits über die Verdunstung – auch ohne sichtbaren Schweiß auf der Haut – führt dies zwangsläufig zu einem erhöhten Flüssigkeitsverlust. Dieser Verlust kann häufig deutlich höher sein als das Flüssigkeitsvolumen, das physiologisch in derselben Zeit während gesteigerter körperlicher Aktivität (z.B. während des Sports) aufgenommen werden kann.
Eine bedeutende Einschränkung hierbei ist die während der Belastung reduzierte Magenpassagezeit, die den Weitertransport des aufgenommenen Flüssigkeitsvolumens innerhalb eines bestimmten Zeitfensters begrenzt. Verschiedene Faktoren, wie die Außentemperatur, die Intensität der Belastung, das Ausmaß bereits vorliegender Dehydratation, der Kohlenhydrat- und Säuregehalt sowie die Volumengröße und Temperatur des Getränkes, ebenso wie die gleichzeitige Nahrungszufuhr können die Magenpassagezeit zusätzlich verlangsamen (siehe Details im entsprechenden Kapitel).
Bei längeren oder intensiven Belastungen (bei Sport über eine Stunde – und bei sehr heißen Temperaturen besser bereits ab 30 Minuten) ist es besonders wichtig, während des Sports regelmäßig zu trinken.
Abhängig von der Intensität und den äußeren Bedingungen sind bestimmte Trinkmengen zu empfehlen: Nach Körpergewicht (für 50 – 70 – 90 kgKG): bei 18°C Außentemperatur etwa 400 – 600 – 800 ml pro Stunde; und bei 28°C Außentemperatur 1 – 1,2 – 1,7 L pro Stunde. (kgKG = kg Körpergewicht)
Für Kinder empfehle ich entsprechend dem Körpergewicht gleiche Relationen, obwohl Kinder öfters wohl geringer schwitzen (siehe Kapitel zu Kindern und Jugendlichen) – also z.B. ein Kind mit 35kgKG sollte bei 28°C Außentemperatur 700ml pro Stunde trinken, wenn es intensiv dabei Sport macht.
Isotone oder leicht hypotone Getränke mit einem adäquaten Verhältnis zwischen Kohlenhydraten und Natriumchlorid helfen, den Flüssigkeits- und Elektrolytverlust (Natriumhaushalt) auszugleichen. Dies ist besonders bei intensiven bzw. langen Ausdauerbelastungen wichtig, um die stärkere Dehydratation und auch die Hyponatriämie zu vermeiden, die Krämpfe bis hin zu schwerwiegende Risiken zur Folge haben kann.
Da bei längeren sportlichen Belastungen es in der Regel zu einem Flüssigkeitsdefizit kommt, weil die Aufnahme von Flüssigkeit während des Sports den Verlust oft nicht vollständig ausgleichen kann, spielt die Rehydrierung in der Regenerationsphase eine entscheidende Rolle. In der ersten Regenerationsphase stellt dies sogar die wichtigste Maßnahme dar.
Eine angemessene Flüssigkeitszufuhr nach dem Training oder der Competition ist essenziell, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen und die Regeneration des Körpers zu unterstützen. Dies ist besonders wichtig, wenn Competitions über mehrere Tage stattfinden oder täglich trainiert wird. Die Trainingseffekte in den folgenden Tagen werden dadurch signifikant verbessert.
Das Trinken bzw. die Zufuhr des benötigten Flüssigkeitsvolumens sollte trainiert und nach Plan umgesetzt werden. Das Trinken nach Gusto (nach Belieben) und Abwarten bis zum Durstgefühl funktioniert nicht gut. Oft entsteht Durst erst, wenn bereits 2% Dehydratation vorliegt (das führt bereits zu signifikantem Leistungsverlust); und wenn z.B. 2 Liter Defizit vorliegen, ist nach dem Trinken von 500ml bereits der größte Teil des Durstgefühls gestillt.
Regeneration und Wiederauffüllung der Wasser- und Glykogenspeicher
Die Regeneration bereits während und dann unmittelbar nach dem Sport ist von zentraler Bedeutung für die Leistungsfähigkeit und optimale Trainingseffekte. Während bedeutet, das Maß der Dehydration durch das Trinken soweit es geht zu reduzieren und nach dem Sport die komplette Rehydrierung abzuschließen. Exakt betrachtet, muss man sagen, dass auch die gute Vorbereitung vor dem Sport bereits für die Regeneration bedeutende Effekte hat.
Also: Um die Regeneration optimal vorzubereiten, sollte der Sport ohne vorheriges Flüssigkeitsdefizit begonnen werden (im Alltag sowie in der Sportvorbereitung reichlich trinken!) und während des Trainings oder der Competition sollte regelmäßig so viel wie möglich Flüssigkeit getrunken werden, um so gut wie möglich dann schon das Rehydrieren zu beginnen.
Eine angemessene Flüssigkeitszufuhr vor – während – und nach der Aktivität trägt dazu bei, den Körper leistungsfähig zu halten und die Regeneration nach dem Sport zu unterstützen, was dann die folgende Belastungsfähigkeit beschleunigt bzw. steigert und folgende Trainingseffekte verbessert.
In den nach dem Sport folgenden Regenerations-phasen sollte innerhalb der ersten 30 Minuten nach der Belastung die weitere Rehydrierung beginnen. Der Ausgleich des Flüssigkeitsdefizits steht an erster Stelle; Kohlenhydrate werden nicht immer zwingend gebraucht.
Die empfohlene Flüssigkeitsmenge sollte 150% des Dehydratationsvolumens* betragen und innerhalb von 2-3 Stunden ausgeglichen werden.
*(d.h. das 1,5fache des verlorenen Schweißes, was i.d.R. der Differenz des Körpergewichts von kurz vor und kurz nach der Aktivität entspricht – z.B. bei 1kg Gewichtsverlust 1,5L Getränk).
Besonders wenn in Kürze eine erneute Belastung geplant ist (Training oder Competition am gleichen oder folgenden Tag), ist es wichtig, die Flüssigkeitszufuhr unmittelbar fortzusetzen und gleichzeitig Kohlenhydrate sowie Natrium zuzuführen.
Alternative bei Magen-Darm-Unverträglichkeit durch zu hohe Kohlenhydratdosen
Für die Rehydratation und Wiederauffüllung der Glykogenspeicher ist eine Kombination aus Kohlenhydraten (0,8g/kg Körpergewicht) und Proteinen (0,4g/kg Körpergewicht) über die Getränke -z.B. Sportgetränk plus Kakaogetränk möglich, wenn bereits zuvor während einer längeren Sporteinheit hohe Kohlenhydratmen-gen zugeführt wurden und der Darm dadurch zu Unverträglichkeit neigen kann (die Toleranz-schwelle erreicht wurde).
Für den Muskelstoffwechsel und den Muskelaufbau ist der Proteinanteil zu diesem Zeitpunkt jedoch weniger entscheidend, da die anabolen Effekte (Muskelaufbau) in erster Linie von einer langfristig guten Proteinversorgung abhängen und nur wenig von der unmittelbaren Protein-zufuhr nach dem Sport (siehe extra Kapitel zu Protein).
Die Kohlenhydrate und Proteine können über Getränke (z.B. Sportgetränke) oder Nahrungsmittel (z.B. Kakaogetränke, Gebäck – jeweils fettarm) zugeführt werden. Es ist wichtig, während der ersten Regenerationsphase auf leicht verdauliche Nahrungsmittel zu setzen, um die Kohlenhydrataufnahme zu optimieren und die Rehydratation nicht zu sehr zu verzögern. Es sollten zu dieser Phase nicht zu viel Protein und noch weniger Fett konsumiert werden.
Die Zufuhr von Fetten sollte in der Regenerationsphase zunächst zurückhaltend erfolgen, da zu viel Fett die Geschwindigkeit der Rehydrierung und Kohlenhydratverwertung beeinträchtigen kann. (siehe unten mehr zur Fettzufuhr)
Natriumchlorid zusätzlich
Bei hohem Schweißverlust ist es unbedingt wichtig, neben dem Flüssigkeitsvolumen und der Kohlenhydratdosis auch auf den Gehalt an Natriumchlorid (NaCl = Kochsalz) in Rehydrierungsgetränken zu achten. Nach einem hohen Schweißverlust kann das Trinken größerer Mengen Wasser mit zu geringem Natrium-Gehalt (sowohl Leitungswasser als auch viele Mineralwässer haben für diesen Fall des sehr hohen Schweißverlustes zu geringe Dosen NaCl). Das kann zu Hyponatriämie führen, die zusammen mit der Dehydratation zu verschiedenen Problemen führen kann – im Extremfall zu schwerwiegenden Risiken wie durch ein Hirnödem. Der Natriumgehalt* des Getränks sollte nach hohem und längerem Schweißverlust idealerweise zwischen 1-2 g NaCl pro Liter liegen (individuell teils höher).
*Anmerkung: Bei der Alltagsernährung liegt sehr oft bereits ein zu hoher Salzkonsum vor (durch Fertigprodukte und/oder eigenes Zusalzen). Dort sollte der Salzkonsum aus präventionsmedizinischer Sicht reduziert werden! Das Salz in einem Sportgetränk steht in einem anderen Zusammenhang; es hat dort den Zweck, dass beim Trinken von hohen Mengen Getränk (z.B. über 3-4 Liter innerhalb kurzer Zeit) die Flüssigkeit nicht zu hypoton ist (ein Risikofaktor für die Verlagerung der Flüssigkeit in die Zellen statt ins Plasma, wo es gebraucht wird) und das über den Schweiß verlorene Natriumchlorid wieder im Plasma ersetzt wird.
Merke
Bei starkem Schweißverlust, insbesondere während längerer Trainingseinheiten oder Competitions wie Marathons oder Triathlons, ist es unbedingt notwendig, Salz im Getränk zu haben.
Bei hohem Salzgehalt im Schweiß und bei längerem Schweißverlust, ist es besonders wichtiger, dass das isotonische Sportgetränke neben den Kohlenhydraten genügend Natriumchlorid (NaCl) enthält, um den Elektrolytverlust auszugleichen. In solchen Fällen ist es wahrscheinlich, dass 2g oder gar mehr Natriumchlorid pro Liter Sportgetränk empfohlen sind. Bei 2g NaCl entspricht dies 0,786 g Natrium im Getränk. (siehe unten Anmerkung Natrium Molmasse).
Der Begriff „isotonisch“ sagt dabei nicht automatisch aus, wie viel bzw. ob genügend Natriumchlorid enthalten ist.
Es kann notwendig sein, die Salzdosis individuell anzupassen, insbesondere wenn der Salzgehalt im Schweiß sehr hoch ist. Dies zeigt sich häufig an der Sportkleidung, die nach dem Training getrocknet mit einem deutlichen Salzrand versehen ist. In solchen Fällen kann zusätzlich zum Getränk auch der Verzehr von Salzgebäck oder gar eine Salztablette sinnvoll sein, um den Natriumbedarf zu decken und die Regeneration zu unterstützen.
Anmerkung „Molmasse“ Natrium und Chlorid („Kochsalz“):
Die meisten Sportler dürften mit 1g Natrium pro Liter Getränk auskommen – das entspricht also 2,54g NaCl (Natriumchlorid) pro Liter Getränk.
Die molare Masse von Natrium (Na) beträgt etwa 22,99 g/mol, die von Chlor (Cl) etwa 35,45 g/mol.
Bei einem Sportgetränk-Pulver zum Mixen, das beispielsweise pro 50g Pulver 0,89g Salz (NaCl) enthält, und diese Menge für 750 ml vom Hersteller angegeben ist, müsste etwa 1,2g Salz (NaCl) für 1 Liter verwendet werden, um die Salzkonzentration zu bewahren. Bräuchte man diese Salzkonzentration von 1,2g pro Liter, dann müsste man etwa 67,4g Pulver für ein Liter Getränk verwenden.
Da die die „Isotonie“ sich immer aus der Kombination mehrerer Inhaltstoffe ergibt (beim Sportgetränk im Wesentlichen den Kohlenhydraten und Natriumchlorid) ändert sich das Verhältnis, wenn man statt der angegeben Pulvermenge oder Flüssigkeitsmenge andere Dosen verwendet. Wird mehr Salz benötigt, muss in manchen Fällen bei den Kohlenhydraten (z.B. Dextrose, Maltodextrin, Fruktose) eingespart werden, wenn man das Getränk nicht zu hyperton haben darf. (selbst Sportgetränk mixen – siehe Teil 2 Praktische Anleitungen)
Wenn tatsächlich 2 g Natrium benötigt wird, entspricht dies bei Kochsalz (Natrium-Chlorid) etwa 5g.
Merke
Am wichtigsten zur ersten Regenerationsphase sind
- die Flüssigkeit und
- die Kohlenhydrate;
- an Stelle die Proteine (immer mit Kohlenhydraten zusammen – und die Kohlenhydrate dominieren auch hier quantitativ deutlich).
Fettzufuhr
Die ausgewogene Fettzufuhr sollte idealerweise erst 4 bis 6 Stunden* nach dem Sport erfolgen. Der Fettanteil in der normalen Tagesnahrung sollte zwischen 20-30% der Tagesenergie # ausmachen und in mehreren Mahlzeiten aufgeteilt werden. Dabei ist es wichtig, vor allem „gesunde“ Fette zu konsumieren, die wenig entzündungsförderndes Potential (oxidativer Stress!) besitzen. Zu den empfehlenswerten Fetten zählen Oliven- und Rapsöl, Leinöl sowie Fette aus Fisch oder Mikroalgenölen, die DHA und EPA als Omega-3-Fettsäuren enthalten. Auch Fette aus Nüssen oder deren Ölen sind eine gute Wahl. In der Ernährungspyramide ist das dargestellt.
Vorsicht!
20-30% Fett gemessen an der Tagesenergie bedeutet lediglich 9-13% gemessen an der Dosis des Makronährstoffanteils. Weil Fett pro Gramm mehr als doppelt so viele Kalorien (ca. 9,2 kcal/g) liefert als Kohlenhydrate oder Proteine (je ca. 4,1 kcal/g), ist dies zu beachten. Die Mengen-Verteilung auf die Makronährstoffe ergibt also die Verteilungsempfehlung grob gerechnet und orientierend: 60-70% Kohlen-hydrate + 15-20% Proteine + 10% Fette >> die gute Qualität sollte beachtet werden [Unter-schiede innerhalb der Makronährstoff-Gruppen]
*In bestimmten Situationen, wie Mehrtages-Competitions oder mehreren Trainingseinheiten am Tag, kann dieser optimale zeitliche Abstand jedoch nicht immer eingehalten werden. Dies ist tolerierbar, da nicht in jeder Vorbereitungsphase oder Trainings-Zyklisierung zwingend die optimalen Verhältnisse erforderlich sind. Stressphasen können helfen, besser an suboptimale Situationen zu adaptieren. Insgesamt sollte in der Ernährung nicht auf Fette verzichtet werden; mindestens 20% der Tagesenergie (also 9% Mengenanteil) sollte aus „gesunden Fettquellen“ stammen. Eine Fettzufuhr unterhalb davon kann Nachteile bewirken; der Organismus braucht die Fette z.B. für die Hormonbildung, für das Nervensystem (Gehirn etc.), für den Stoffwechsel, für die gute Aufnahme von fettlöslichen Mikronährstoffen.
Merke
Während der ersten Regenerationsphase, die unmittelbar bis etwa 2-3 Stunden nach der Belastung dauert, sollte der Fokus zunächst auf der Flüssigkeitszufuhr liegen. Beim Leistungssport (über die Dauer über einer Stunde) ist es oft von Vorteil und teils wichtig, eine Kombination aus Flüssigkeit, Kohlenhydraten und Salz zu konsumieren. Im Verlauf dieser Phase sollten die Nahrungsmittel leicht und schnell verdaubar sein, wobei auch hier die gut kohlenhydrathaltigen Lebensmittel bevorzugt werden. Geeignete Optionen sind beispielsweise Obst, fettarmes süßes oder salziges Gebäck sowie Nudelgerichte. Ein geringer Proteinanteil kann auch bereits enthalten sein (das bringt vor allem Vorteilen, wenn der Magen-Darm-Trakt zuvor durch hohe Kohlenhydratdosen an die Toleranzschwelle gekommen ist).
In der weiteren Regenerationsphase, nachdem das optimale Zeitfenster für die Rehydratation und die ersten Schritte für die Wiederauffüllung der Glykogenspeicher genutzt wurde, kann eine vollwertige Mahlzeit folgen. Diese sollte jedoch weiterhin einen niedrigen Fettgehalt aufweisen, um einen optimalen Glycogenstoffwechsel (z.B. für die nächsten Trainingseinheiten) zu gewährleisten. Auf diese Weise werden die Regeneration des Körpers und die Trainingseffekte von Seiten der Ernährung bestmöglich unterstützt.
Langfristige Gesundheitsförderung
Eine ausgewogene Nahrungszusammenstellung (entsprechend der Ernährungspyramide und Mengenverhältnisse der Ernährungskreise) liefert alle Makro- und Mikronährstoffe* und kann insbesondere über die Sekundären Pflanzenstoffe und Vitamine den oxidativen Stress während und nach dem Sport reduzieren. Das reduziert Schäden an Zellstrukturen sowie am DNA-Strang und hilft dem Körper, auch schneller zu regenerieren. *(liefert alle Makronährstoffe außer in Regionen nördlicher Breitengrade in der Winterzeit mit zu geringen Sonnenstrahlen, wodurch nicht genügend Vitamin D über die Haut gebildet wird. (siehe Lehrbrief zu Vitamin D)
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die optimal abgestimmte Sporternährung für Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche nicht nur auf die unmittelbare Leistungsoptimierung abzielt, sondern auch eine Schlüsselrolle in der langfristigen Gesundheitsförderung spielt. Ein adäquates Trainingskonzept ist der entscheidende Faktor für die Leistungssteigerung, während die Ernährung unterstützend wirkt. Sie kann kein unzureichendes Training ausgleichen. Ziel sollte es sein, Defizite zu vermeiden und die Regeneration zu optimieren, um die Trainingseffekte zu maximieren und eine nachhaltige Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Die Kombination aus Training, Ernährung und Regeneration, in einer guten Qualität und guten Balance, ist entscheidend für eine langfristige Gesundheit und Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter.
Anhang - Weitere Anmerkungen zu Kindern und Jugendlichen
Kohlenhydrate
Auch zu Kohlenhydraten, kann man die gleichen Aussagen wie bei den Erwachsenen Sportlern treffen (siehe oben).
Die Kohlenhydratzufuhr aus Lebensmitteln mit einem niedrigen glykämischen Index (langsame Kohlenhydrat-Verstoffwechslung) ist im Allgemeinen gesünder, doch je nach Sportart bzw. Belastungsphase (Trainingsumfang und Trainingsintensität) sind schnell verfügbare Kohlenhydrate von Vorteil (nur wenn sie auch schnell in der Muskulatur verbrannt werden).
Flüssigkeitszufuhr
Ebenso zu der Flüssigkeitszufuhr kann man die gleichen Aussagen wie bei den Erwachsenen Sportlern treffen (siehe oben).
Es gibt manche Untersuchungen, die vermuten, dass Kinder eine geringere Schweißproduktion beim Sport verglichen zu Erwachsenen haben, doch da solche Messungen schwierig sind und dies sehr variabel ist, sowie ohnehin meist vor, während und nach dem Sport mehr getrunken werden sollte, als üblich oder möglich ist, sollte besser mehr als zu wenig getrunken werden.
Wie dargestellt, verliert man während des Sports durch das zur Thermoregulation notwendige Schwitzen schneller Wasser (Dehydratation), als man es während der Belastung wieder zuführen kann (Rehydratation). Die während dem Sport verzögerte Magenpassagezeit und zeitlich limitierte Aufnahme der Flüssigkeit über den Darm machen es notwendig, dass man für den Sport bereits vorher reichlich trinkt und Wasserreserven erhöht. Das trifft auch für die Kinder und Jugendlichen zu.
Die Empfehlungen zur Flüssigkeitszufuhr lassen sich in ähnlicher Weise wie die Vorgaben für erwachsene Sportler formulieren. Verschiedene Studien deuten zwar darauf hin, dass Kinder möglicherweise eine geringere Schweißproduktion während sportlicher Aktivitäten aufweisen als Erwachsene, doch da solche Messungen kompliziert sind und die Ergebnisse stark variieren können, ist zu empfehlen, hierbei nicht bei der Flüssigkeitszufuhr einzusparen. Insbesondere auch, weil die Notwendigkeit besteht, vor, während und nach dem Sport mehr zu trinken, als normalerweise erforderlich wäre, sollte eine höhere Flüssigkeitsaufnahme angestrebt werden, anstatt zu wenig zu konsumieren.
Zur Erinnerung: Während des Sports verliert der Körper durch das Schwitzen, welches zur Thermoregulation dient, schneller Wasser (Dehydratation), als es während der Belastung wieder aufgenommen werden kann (Rehydratation). Die verzögerte Magenpassagezeit und die zeitlich begrenzte Flüssigkeitsaufnahme über den Darm verdeutlichen die Notwendigkeit, bereits im Vorfeld ausreichend zu trinken, um die Wasserreserven zu erhöhen. Dies gilt ebenso für Kinder und Jugendliche.
Proteine
Der Proteinbedarf ist in Wachstumsphasen etwas erhöht, doch aufgrund der dann auch gesteigerten Portionsgrößen der Lebensmittel decken die Kinder und Jugendlichen dies bei ausgewogener Nahrungskomposition leicht. Die Angabe von Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht wird öfters gemacht, doch dies ist abstrakt und fokussiert den Blick zu sehr auf die Proteine. Besser ist die Orientierung an der ausgewogenen Komposition wie im Ernährungskreis dargestellt (siehe Lehrbrief) – die Prozentzahlen zu den Lebensmittelgruppen-Verteilung können hier bei Kindern und Erwachsenen gleich eingestuft werden. Anmerkung: Selbst vegan kann man mehr als genügend Proteine zuführen, wenn man die Hülsenfrüchte und Samen im Speiseplan steigert.
Auch vegetarisch oder gar vegan kann man sich gut mit genügend Protein versorgen.
Beide Ernährungsformen können, sofern be-stimmte Ergänzungen und Analysen berücksichtigt werden, zu einer ausgewogenen und guten Ernährung führen. Die vegetarische Kost stellt dabei eine geringere Herausforderung dar, da Mangelerscheinungen leichter vermieden werden können als bei einer veganen Ernährung.
Bei Kindern sollte man mit einer veganen Ernährung vorsichtiger sein und manches kontrollieren lassen.
Fachgesellschaften (DGE etc.) und ernährungswissenschaftliche Institutionen betonen, dass eine gut geplante vegetarische Ernährung gesundheitliche Vorteile bieten kann. Eine vegane Ernährung hingegen besonders sorgfältig geplant bzw. adäquat umgesetzt werden sollte, um sicherzustellen, dass die notwendigen Nährstoffe, wie Vitamin B12, Eisen, Calcium und Omega-3-Fettsäuren, ausreichend aufgenommen werden.
Eltern sollten sich umfassend mit der Ernährung ihrer Kinder auseinandersetzen (auskennen). Bei einer veganen Ernährung ist ein noch höheres
Maß an Wissen erforderlich, um gezielte Lebensmittelkombinationen zu gewährleisten und nötigenfalls die Ergänzung von Mikronährstoffen oder Spurenelementen durch Nahrungsergänzungen sicherzustellen. Bei der veganen Ernährung bedarf es zwingend der Supplementation von Vitamin B12 durch Präparate, sofern keine mit Vitamin B12 angereicherten Lebensmittel in den Speiseplan integriert sind. Auch die Versorgung mit Vitamin D über eine Supplementation ist unter bestimmten Bedingungen (z.B. in der Winterzeit) angeraten. (zu den Themen vegetarischen und vegane Ernährung sowie zu Vitamin D folgen Lehrbriefe)
Besonders bei Kindern sollte eine vegane Ernährungsweise mit Vorsicht betrachtet werden, und es empfiehlt sich eine regelmäßige Kontrolle von Nährstoffwerten. Fachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) und andere ernährungswissenschaftliche Institutionen heben hervor, dass eine sorgfältig geplante vegetarische Ernährung gesundheitliche Vorteile bieten kann.
Eine vegane Ernährung erfordert eine besonders präzise Planung, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Nährstoffe, wie Vitamin B12, Eisen, Calcium und Omega-3-Fettsäuren, in ausreichenden Mengen aufgenommen werden. Da es zu wenige Studien-Daten zum Versorgungsstatus vegan ernährter Kindern und Jugendlichen in Deutschland gibt, empfiehlt die DGE in ihrem Positionspapier die vegetarische Ernährung als Dauerkost geeignet, doch die vegane Ernährung für diese Gruppen nicht (DGE Wissenschaft zu veganer Kost bei Kindern, Jugendlichen, Schwangeren und Stillenden).
Es ist empfohlen, dass Eltern sich von Fachleuten beraten lassen, wenn sie eine vegetarische und insbesondere eine überwiegend vegane Ernährung für ihre Kinder in Betracht ziehen.
Der individuelle Proteinbedarf kann nicht pauschal festgelegt werden, da er stark von Faktoren wie der persönlichen Wachstumsgeschwindigkeit, der Art des Trainings und der Körperzusammensetzung abhängt. In Phasen schnellen Wachstums ist der Proteinbedarf allgemein erhöht, und bei erhöhtem muskulärem Umsatz durch sportliche Betätigung kann es sinnvoll sein, die Proteinzufuhr zeitweise ein wenig zu steigern.
Obwohl die Angabe der Grammzahl pro Körpergewicht pro Tag häufig verwendet wird, macht es nicht unbedingt Sinn, diese als Maßstab zu betrachten. Viel wichtiger sind das Timing der Zufuhr, insbesondere vor und nach dem Training, sowie die Verteilung der Proteinzufuhr über den Tag und die Woche. Daher sollte diese Zahl mit Vorsicht betrachtet werden, da sie lediglich einen Anhaltspunkt bietet und nicht die gesamte Komplexität der Proteinaufnahme widerspiegelt.
Ich liste Ihnen unter Vorbehalt die Proteingramm-zahl pro Kilogramm-Körpergewicht auf, da viele Sportler sich daran orientieren. Statt der Orientierung lediglich an der Dosis, ist viel mehr das Timing (Zeitpunkt der Zufuhr vor und nach der Belastung) und die Verteilung über den Tag sowie Wochen entscheidend.
Allgemein (ohne besondere erhöhte Belastung) liegt die empfohlene Proteindosis bei Erwachsenen* etwa bei 0,8g/kgKG/Tag bei Kindern ab dem 4. Lebensjahr leicht darüber bei etwa 0,9g/kgKG/Tag. * (von 19-65 Jahren – bei älteren etwa bei 1g/kgKG/Tag)
- Bei intensiver sportlicher Betätigung kann die empfohlene Proteinzufuhr für Jugendliche und Erwachsene zwischen 1,2 und 2,0 g / kgKG / Tag liegen, abhängig vom Trainingszustand und den spezifischen Trainingszielen.
- In der Regel sind 1,2 bis 1,6 g / kgKG / Tag mehr als ausreichend.
Eine etwas höhere Zufuhr wird heutzutage, selbst bei langfristiger Erhöhung, nicht mehr als Risiko für beispielsweise Nierensteine betrachtet, dennoch kann eine übermäßige Proteinzufuhr andere Nach-teile mit sich bringen, da sie die Ernährungszusammensetzung häufiger unausgewogener werden lässt.
Timing (Zeitpunkt der Proteinzufuhr vor und nach der Belastung)
Zum Timing lässt sich das gleiche Konzept empfehlen, wie bei den Erwachsenen, denn für eine gute Performance sind auch hier vorrangig die Kohlenhydrate und die Flüssigkeitszufuhr zur schnellen Metabolisierung wichtig, und sowohl Proteine wie auch Fette können dies zu bestimmten Phasen verlangsamen. Daher ist je nach Belastungsphase ein zeitlicher Abstand zwischen der leistungsoptimierenden Kohlenhydrat- sowie der Flüssigkeitszufuhr zu den Proteinen und Fetten von Vorteil.
Beim Timing über den Tag sollte die Gesamtmenge auf 3-5 Portionen verteilt sein. In einem Zeitfenster von circa 4 Stunden sieht man meist bei bereits 20g (0,2-03g/kgKG) hochwertiger Proteine einen sogenannten „Muskelvolleffekt“. Das heißt, mehr Proteine können innerhalb dieses Zeitfensters ohnehin nicht in dem Muskelstoffwechsel verwertet werden.
Übrigens sind die Kohlenhydrate auch für den Muskelaufbau essentiell. Der Muskelstoffwechseln und anabole Effekte; man kann diesbezüglich nicht nur auf die Proteine fokussieren. (siehe extra Artikel zum Proteinbedarf)
Fette
Zu dem Nahrungsfett kann man die gleichen Aussagen wie bei den Erwachsenen Sportlern treffen (siehe oben).
Zwar weisen Kinder und Jugendliche i.d.R. höhere Fettoxidationsraten als Erwachsene auf, doch die Empfehlungen sind die gleichen wie bei der allgemeinen Bevölkerung (30-35% der Gesamtenergie – bei Leistungssport eher 25-30% – nicht unter 20% – Achtung das sind dann nur etwa 10% der Mengenanteile – siehe oben). Wie bei allen Menschen ist es wichtig, dass qualitativ gute Fette wie Raps- und Olivenöl, Leinöl, Nüsse, Samen (z.B. Cashew-, Sonnenblumen- und Kürbiskerne) und Kaltmeeresfisch Fisch (z.B. Hering, Lachs, Makrele) konsumiert werden (zu besonderen Phasen der Hirnreifung scheinen die Omega-3-Fettsäuren besonders wichtig!)
Freilich sollten Fast-Food, hoch verarbeitete Fertigprodukte, Frittiertes, Wurstware, fettes Fleisch, fette Milchprodukte (Butter, Sahne), fetthaltiges Gebäck, etc. lediglich in geringem Umfang konsumiert werden. Zu bestimmten Phasen, wenn eine höhere Performance im Training oder in der Competition notwendig ist, oder eine schnellere Regeneration gewünscht wird, sollten solche Produkte eher gemieden werden.
Es wird immer empfohlen bei Krankheiten oder Beschwerden den persönlichen Arzt zu konsultieren.
Nutzungsbedingungen: Die Inhalte dieses Artikels oder Lehrbriefes dienen Bildungszwecken und stellen keine persönliche medizinische Beratung dar. Bei Fragen zu einer Erkrankung sollten Sie stets den Rat Ihres Arztes oder eines anderen qualifizierten Gesundheitsdienstleisters einholen. Es ist wichtig, dass Sie niemals den professionellen medizinischen Rat ignorieren oder zögern, diesen einzuholen, nur weil Sie etwas auf dieser Website oder den Informationsmaterialien gelesen haben. Die bereitgestellten Informationen dienen lediglich der allgemeinen Aufklärung und sollten nicht als Ersatz für eine persönliche Beratung durch qualifizierte medizinische Fachkräfte, die Sie vor Ort beurteilen können, betrachtet werden.